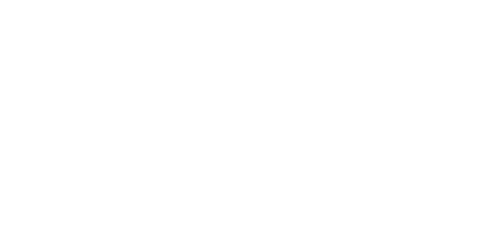
Wie beantrage ich Eingliederunghilfe?
Informationen zur Beantragung von Eingliederungshilfe
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Klient*innen
Was ist Eingliederungshilfe?
Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung, die Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Personen dabei unterstützen soll, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ziel ist es, Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung, Freizeit und im sozialen Miteinander zu ermöglichen und selbstbestimmte Lebensführung zu fördern. Die Eingliederungshilfe umfasst verschiedene Leistungen, die individuell auf die Bedürfnisse der anspruchsberechtigten Personen zugeschnitten sind.
Wer kann Eingliederungshilfe beantragen?
Einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen, wenn durch die Beeinträchtigung eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert oder gefährdet ist. Die Hilfe kann auch für Kinder und Jugendliche in Anspruch genommen werden, wenn sie in ihrer Entwicklung behindert oder bedroht sind.
Voraussetzungen für die Beantragung
- Bedarf an Unterstützung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland
- Kein Vorrang anderer Sozialleistungen (z. B. Pflegeversicherung, Unfallversicherung)
- Welche Leistungen umfasst die Eingliederungshilfe?
- Hilfen zur medizinischen Rehabilitation
- Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Hilfen zur Teilhabe an Bildung
- Hilfen zur sozialen Teilhabe (Freizeitgestaltung, kulturelle Angebote)
- Assistenzleistungen und persönliche Hilfen
- Wohnformen (z. B. betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften)
1. Beratung und Information
Vor der Antragstellung empfiehlt sich eine ausführliche Beratung bei einem Sozialdienst, einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung oder direkt beim zuständigen Sozialamt. Die Sozialdienste oder Beratungsstellen helfen bei der Klärung des individuellen Bedarfs und geben Hinweise zum Ablauf.
2. Antragstellung
Die Eingliederungshilfe wird schriftlich beim zuständigen Sozialamt oder beim Träger der Eingliederungshilfe (je nach Bundesland unterschiedlich organisiert) gestellt. Viele Ämter bieten die Möglichkeit, Formulare direkt online herunterzuladen oder den Antrag digital einzureichen.
3. Notwendige Unterlagen
- Ausgefülltes Antragsformular
- Ärztliche Gutachten oder Stellungnahmen über die vorliegende Behinderung
- Nachweis über Einkommen und Vermögen
- Nachweis über die Wohnsituation (z. B. Mietvertrag)
- Ggf. Nachweise über zusätzliche Hilfebedarfe (z. B. bei Assistenzleistungen)
Nach Eingang der Unterlagen prüft das Amt den Antrag und den individuellen Bedarf. Es können zusätzliche Stellungnahmen, Gutachten oder Informationen angefordert werden. Die Prüfung kann einige Wochen bis Monate dauern.
5. Erstellung des Gesamtplans
Im Rahmen eines Gesamtplanverfahrens wird gemeinsam mit Ihnen, den Angehörigen und ggf. weiteren Beteiligten (z. B. Betreuer*innen, Therapeut*innen) erfasst, welche Unterstützungsleistungen notwendig und passend sind. Ziel ist es, einen individuellen Hilfeplan zu erstellen.
6. Bewilligung und Beginn der Hilfe
Nach der Prüfung und Planung erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid. Darin sind Umfang, Dauer und Art der bewilligten Leistungen festgelegt. Die Hilfe kann dann in Anspruch genommen werden; oft unterstützen Sozialdienste bei der Organisation und Umsetzung.
Tipps für eine erfolgreiche Antragstellung
- Lassen Sie sich frühzeitig beraten und nehmen Sie Hilfsangebote von Sozialdiensten oder Beratungsstellen wahr.
- Sammeln und prüfen Sie alle notwendigen Unterlagen sorgfältig, um Verzögerungen zu vermeiden.
- Beschreiben Sie den persönlichen Unterstützungsbedarf möglichst konkret und ausführlich.
- Nutzen Sie das Gesamtplanverfahren aktiv, um Ihre Wünsche und Ziele einzubringen.
- Bei Ablehnung oder Teilablehnung der Leistung: Prüfen Sie die Möglichkeit von Widerspruch oder Rechtsmitteln. Beratungsstellen helfen auch hier weiter.
- Wichtige Kontaktstellen und Anlaufpunkte
- Sozialamt Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises
- Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung (z. B. Lebenshilfe, Caritas, DRK)
- Unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB)
- Selbsthilfegruppen und Interessenverbände
Gibt es eine Einkommensgrenze?
Ja, bei der Eingliederungshilfe wird das Einkommen und Vermögen geprüft. Es gelten Freibeträge, die je nach Bundesland und individuellen Umständen unterschiedlich sein können. Beratung hilft, die eigene Situation einzuschätzen.
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Die Bearbeitung eines Antrags kann unterschiedlich lange dauern, oft einige Wochen bis Monate. Eine vollständige und genaue Antragstellung kann den Prozess beschleunigen.
Muss ich die Kosten der Hilfe zurückzahlen?
Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung und muss in der Regel nicht zurückgezahlt werden. Nur wenn Einkommen oder Vermögen bestimmte Grenzen überschreiten, kann eine Beteiligung an den Kosten verlangt werden.
Können Angehörige mitwirken?
Ja, Angehörige können bei der Antragstellung und im Gesamtplanverfahren unterstützen und Wünsche einbringen.
Was tun bei Ablehnung?
Bei Ablehnung des Antrags besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Beratungsstellen können Sie dabei begleiten.
Fazit
Die Beantragung von Eingliederungshilfe ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen. Informieren Sie sich frühzeitig, nutzen Sie Beratungsangebote und gehen Sie die Antragstellung mit Geduld und Sorgfalt an. So können die passenden Hilfen für Ihren individuellen Bedarf gefunden und umgesetzt werden.
Hier können sie für ihre Stadt/ihren Landkreis Eingiederungshilfe beantragen und weitere Informationen erhalten:
Aufgeführt sind die Städte und Landkreise, in denen wir auch selber tätig sind.

